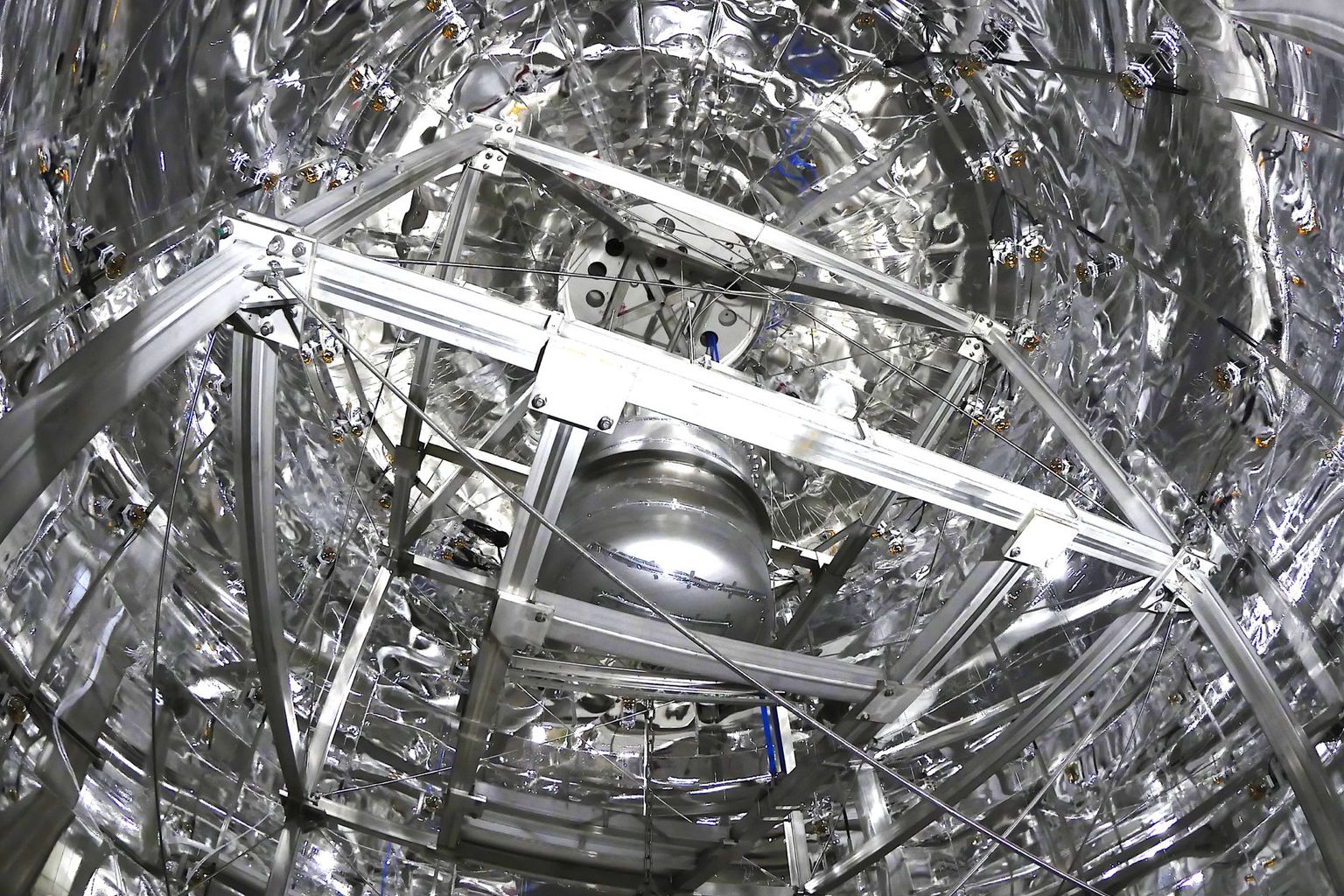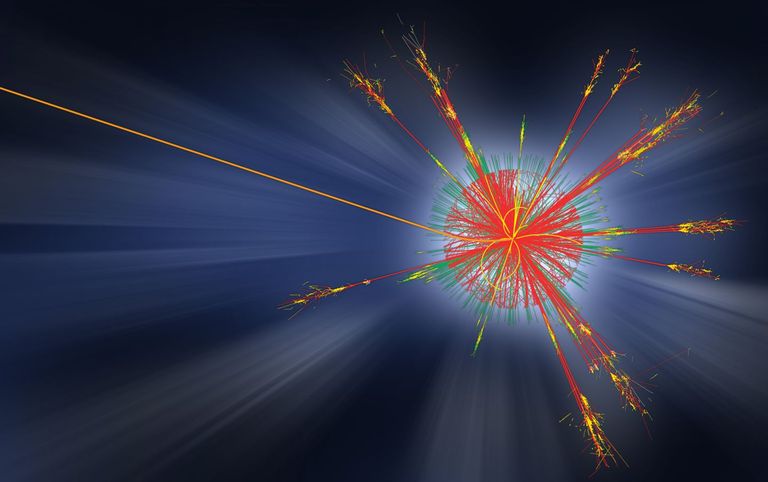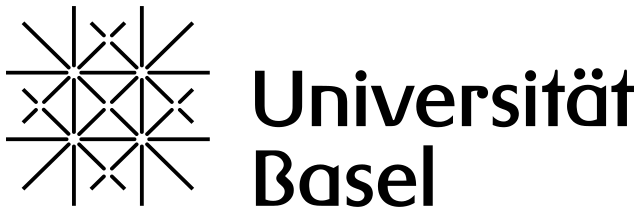- Medienmitteilung
- Meldung
Under the Alps: Assessing the Potential of Bedretto for Particle and Astroparticle Physics
Bild: Google map1/30- Medienmitteilung
- Meldung
Die Schnittstelle zwischen Physik, Mathematik und KI wird immer produktiver
Bild: KI-generiert2/30- Medienmitteilung
- Meldung
Onkel Dagobert entdeckt Teilchenphysik
Bild: Disney3/30- Medienmitteilung
- Meldung
Erster CHIPP-Postdoc-Preis geht an PSI-Postdoc
Bild: CHIPP4/30- Medienmitteilung
- Meldung
CHIPP-Preis 2025: Top Präzision für Top-Quarks
Bild: CHIPP5/30- Meldung
Demo gegen Sparmassnahmen in Bildung und Forschung
Bild: AVETH6/30- Medienmitteilung
- Meldung
Swiss Input to the European Strategy for Particle Physics 2026 Update
Bild: CHIPP7/30Strategic Workshops & Documents
Bild: CHIPP8/30- Medienmitteilung
- Meldung
Dunkle Sirenen singen über dunkle Energie
Bild: CHIPP9/30- Medienmitteilung
- Meldung
Alles, überall, alles auf einmal in der Teilchenphysik
Bild: Video still, Chinese Academy of Science10/30- Medienmitteilung
- Meldung
IMPACT: Upgrade at PSI research facility approved
Bild: Scanderbeg Sauer Photography11/30- Medienmitteilung
- Meldung
Forschende entdecken extrem seltenen Teilchenzerfall
Bild: CERN12/30- Medienmitteilung
- Meldung
„Beim nächsten Neutrino ist es ...“
Bild: Federico Sanchez, U. Geneva13/30- Medienmitteilung
- Meldung
Neutrino-Experiment legt wieder los
Bild: J-PARC/Rey.Hori14/30- Medienmitteilung
- Meldung
Lesya Shchutska ist Preisträgerin des Latsis-Preises 2023
Bild: SNSF, Mathilda Olmi15/30- Medienmitteilung
- Meldung
CHIPP Preis 2023: Auf Entdeckungskurs
Bild: Anne-Mazarine Lyon16/30- Medienmitteilung
- Meldung
Jetzt mit mehr Geschmack: Basel stärkt die Phänomenologie
Bild: Admir Greljo17/30- Medienmitteilung
- Meldung
Neu in den Kantonen: Forschung mit Kaonen
Bild: Radoslav Marchevski18/30- Medienmitteilung
- Meldung
Erste Neutrinos aus einer Teilchenkollision am Beschleuniger gesichtet
Bild: Anna Sfyrla19/30- Medienmitteilung
- Meldung
"Seltsame Gestalten" im Rampenlicht
Bild: U. Bern20/30Women In Science
Bild: CHIPP21/30PhD School
Bild: CHIPP22/30- Medienmitteilung
- Meldung
Hopp Higgs!
Bild: FERMILAB23/30Higgs@10
24/30- Medienmitteilung
- Meldung
Extreme Ereignisse werfen ihre Wellen voraus - Schweizer Beiträge zur Gravitationswellen-Forschung
Bild: Bild: R. Williams (STScI), Hubble Deep Field Team und NASA25/30- Medienmitteilung
- Meldung
Gabriel Cuomo erhält den CHIPP-Preis 2021
Bild: G. Cuomo26/30- Medienmitteilung
- Meldung
Recent Results from LHCb Challenge Leading Theory in Physics
Bild: LHCb, CERN27/30- 2021
- Bericht
CHIPP Roadmap
Bild: SCNAT28/30- Medienmitteilung
- Meldung
Two dark matter detector heavyweights join forces to build new observatory
Bild: XENON experiment29/30- Medienmitteilung
- Meldung
Leading Xenon Researchers unite to build next-generation Dark Matter Detector
Bild: XENON collaboration30/30
The Swiss Institute of Particle Physics (CHIPP) is the bottom-up organisation of Swiss particle and astroparticle physics researchers in Switzerland as a legal entity of Swiss law. CHIPP is tasked with coordinating the national efforts in the realm of particle and astroparticle physics.
This is achieved by keeping a continuous dialogue between the particle physicists of different cantonal universities and federal institutes. CHIPP is recognized as the representative of Swiss particle physics both nationally and internationally. It awards yearly a Prize to a PhD student, supports workshops and conferences, organises PhD schools, and develops outreach projects.
Veranstaltungen, Meldungen, Publikationen
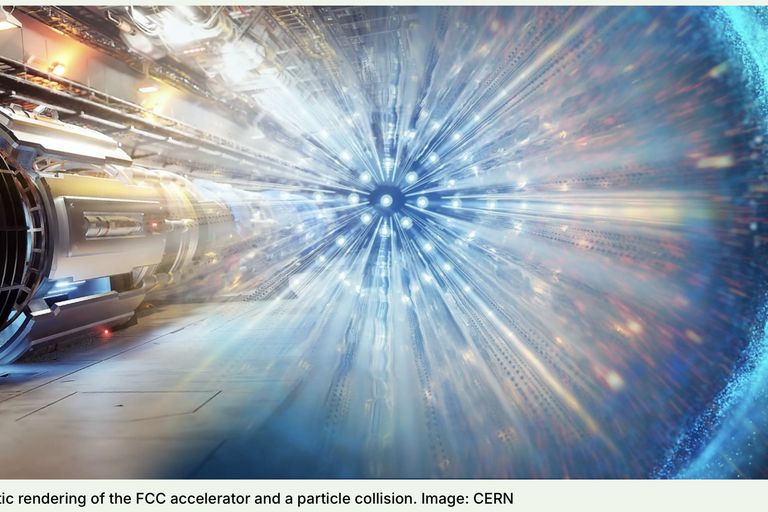
How Switzerland is preparing for the future of particle physics
The European Strategy for Particle Physics is intended to shape the future of particle physics. Under this strategy, the favoured option for the next major project at CERN is the Future Circular Collider. Switzerland seeks to consolidate its expertise in particle physics through targeted support instruments for technology, research and early-career researchers.
Bild: CERN
Under the Alps: Assessing the Potential of Bedretto for Particle and Astroparticle Physics
ETH visits to the Bedretto Underground Laboratory
Bild: Google map
Die Schnittstelle zwischen Physik, Mathematik und KI wird immer produktiver
Physiker und Mathematiker erhalten BRIDGE Discovery Grant zur Optimierung von Lieferketten mit Künstlicher Intelligenz
Bild: KI-generiert
Onkel Dagobert entdeckt Teilchenphysik
Manchmal braucht es nur eine einfache Idee, damit Kinder Spass an Wissenschaft bekommen. Als die Welt im Lockdown war und Eltern überall ihre liebe Mühe damit hatten, das Homeschooling ihrer Kinder zu organisieren, ihre eigene Arbeit zu erledigen und obendrein alle gesund und gut gelaunt zu halten, erinnerte sich der Wissenschaftler Luigi Marchese an seine eigene Kindheit – und hatte eine Idee. Warum nicht das, was er als Kind geliebt hat – Comics lesen, vor allem das italienische „Topolino“ mit Mickey Mouse, Donald Duck und Co – mit dem verbinden, was er heute macht, nämlich Teilchenphysik am CMS-Detektor, um Kinder spielerisch für Wissenschaft zu begeistern?
Bild: Disney
Hinter den Kulissen der Modernisierung des Large Hadron Colliders
Der Large Hadron Collider (LHC) ist ein riesiger Teilchenbeschleuniger, der von mehreren Detektorkollaborationen mit über 10.000 Wissenschaftler:innen genutzt wird, um unser Verständnis der Grundlagenphysik voranzutreiben. Während wir oft über Neuigkeiten wie die Messung neuer Teilchen oder die genaue Bestimmung von Fundamentalkonstanten berichten, möchten wir uns heute auf die weniger sichtbare Arbeit konzentrieren, die für das Funktionieren der LHC-Detektoren erforderlich ist. Wir sprechen mit Dr. Silke Möbius, einer Postdoktorandin, und Camilla Tognina, einer Elektroingenieurin, die ein Auslesesystem für den neuen inneren Detektor (Inner Tracker) des ATLAS-Experiments entwickeln. Dieses Projekt begann 2018 in der Gruppe von Professor Michele Weber an der Universität Bern und umfasste insgesamt 37 Personen in den verschiedenen Phasen des Projekts.
Bild: CHIPP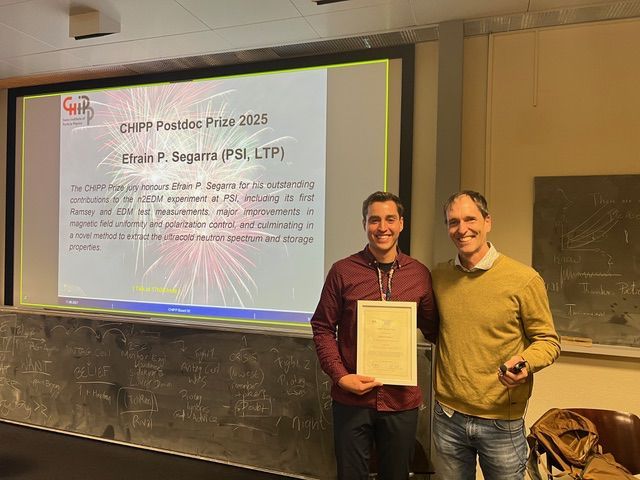
Erster CHIPP-Postdoc-Preis geht an PSI-Postdoc
Efrain P. Segarra wurde für seine Arbeit zu n2EDM ausgezeichnet
Bild: CHIPPKontakt
Swiss Institute of Particle Physics (CHIPP)
c/o Prof. Dr Paolo Crivelli
ETH Zürich
IPA
Otto-Stern-Weg 5
8093 Zürich
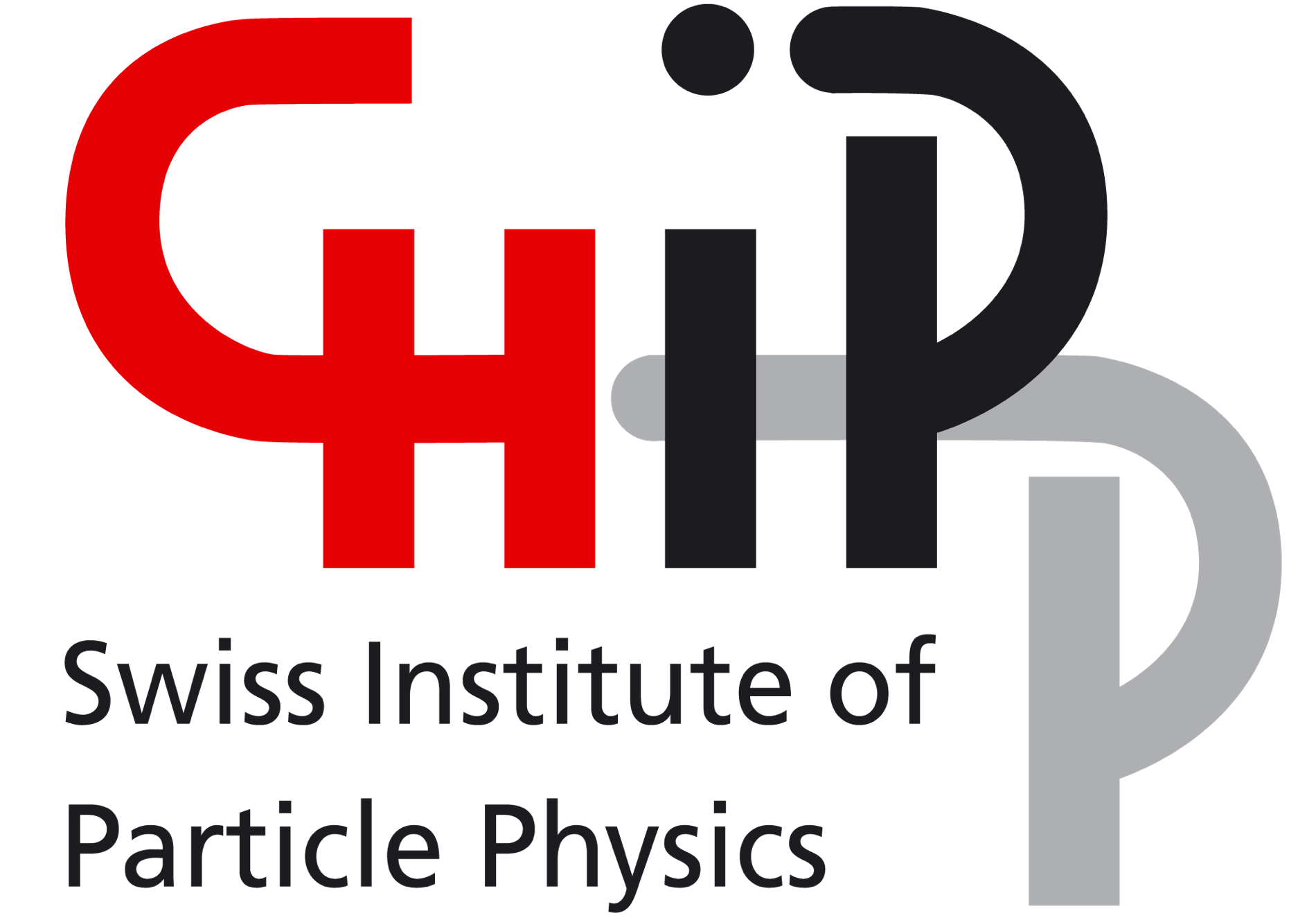



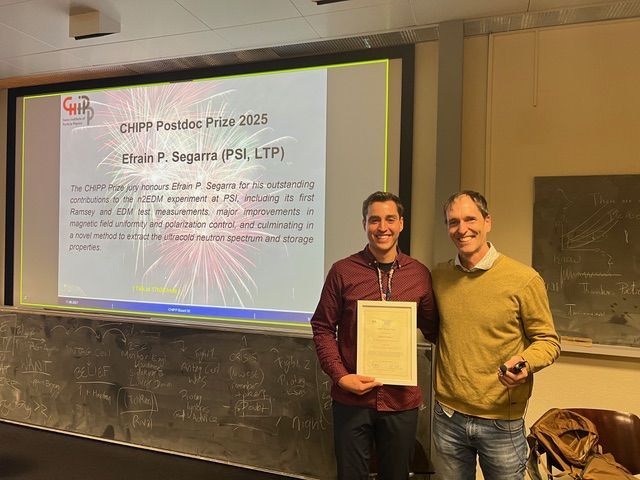




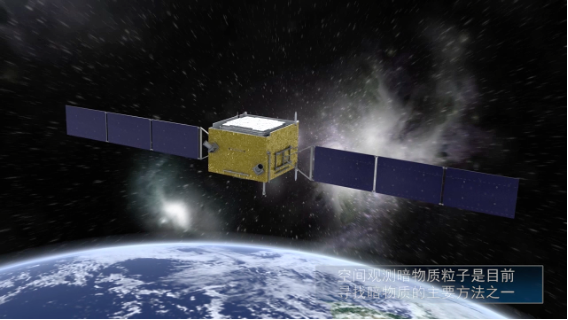


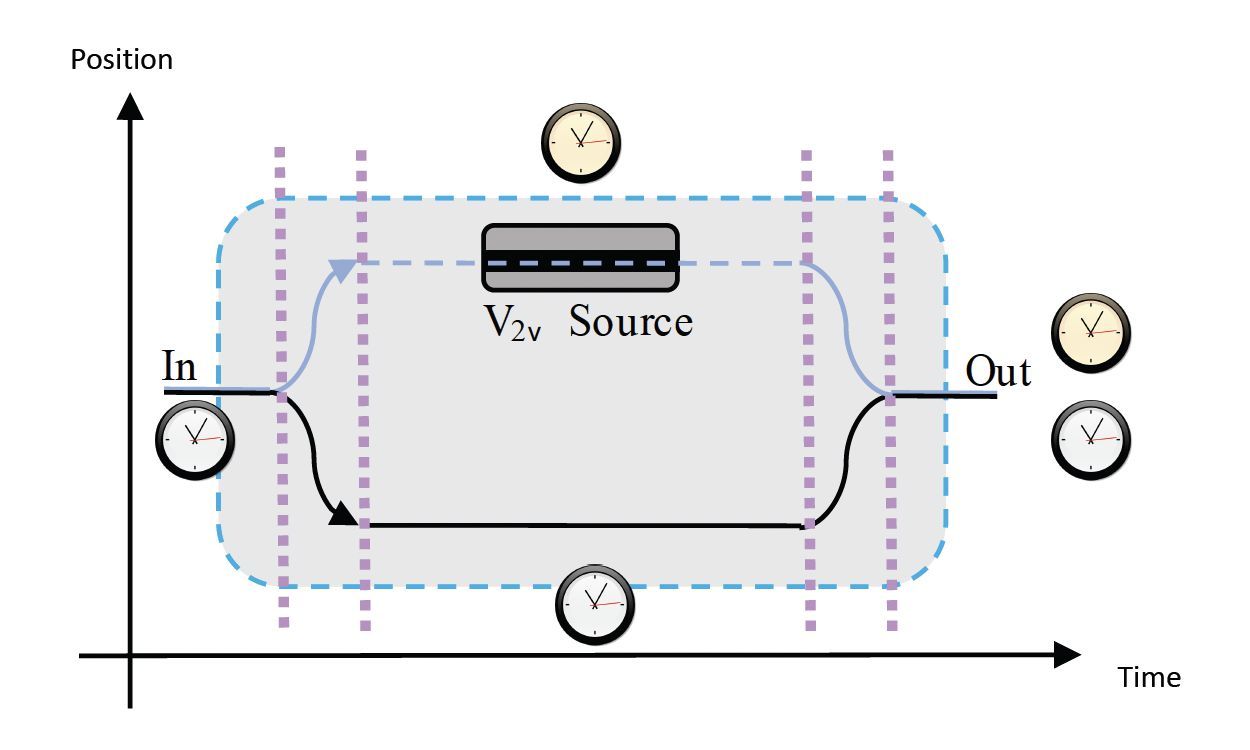
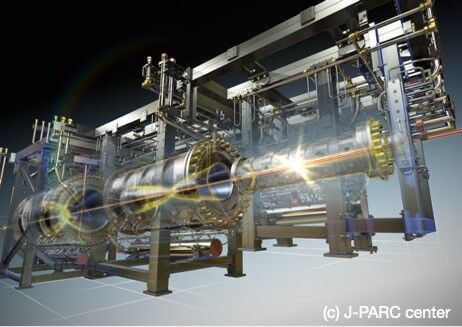



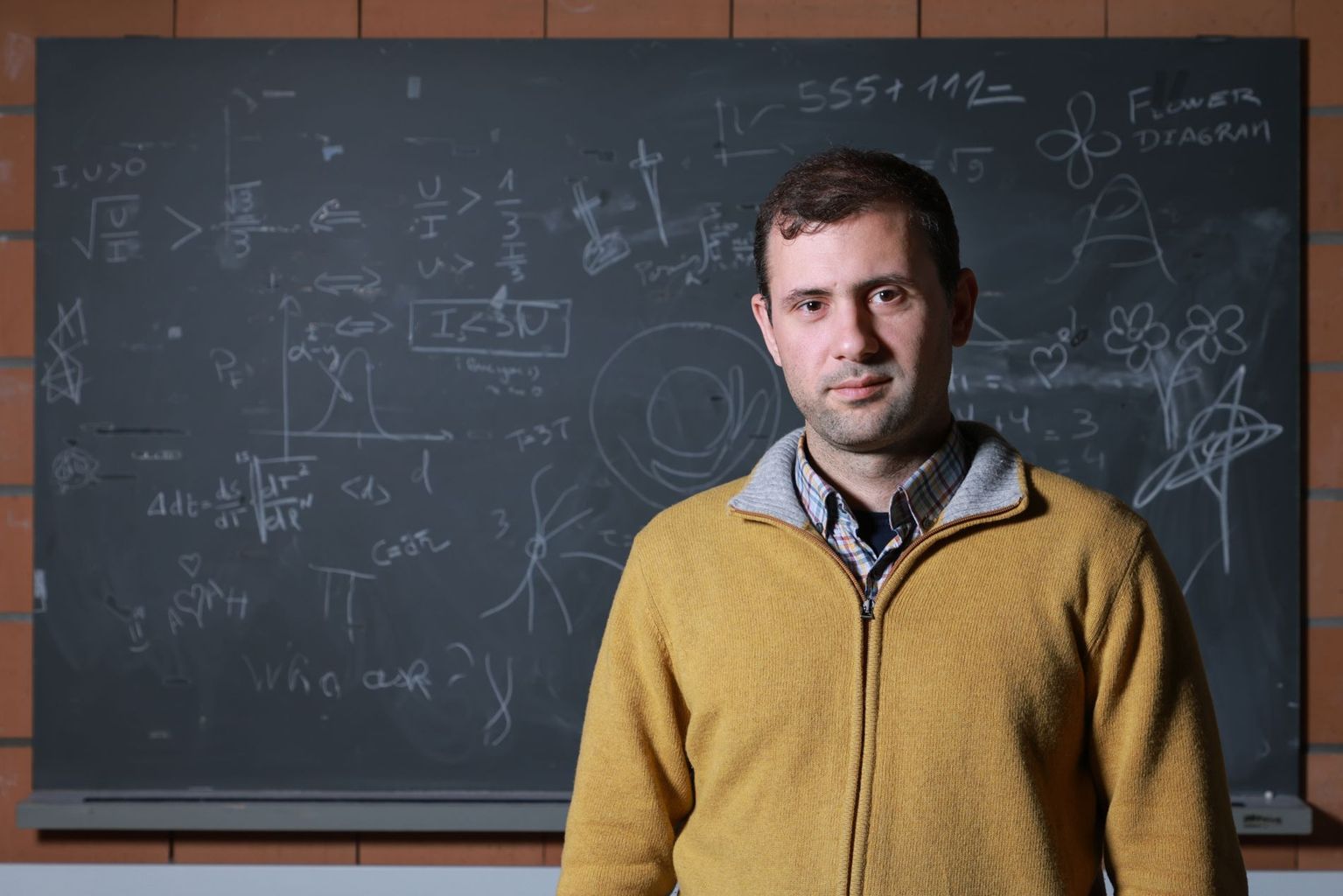
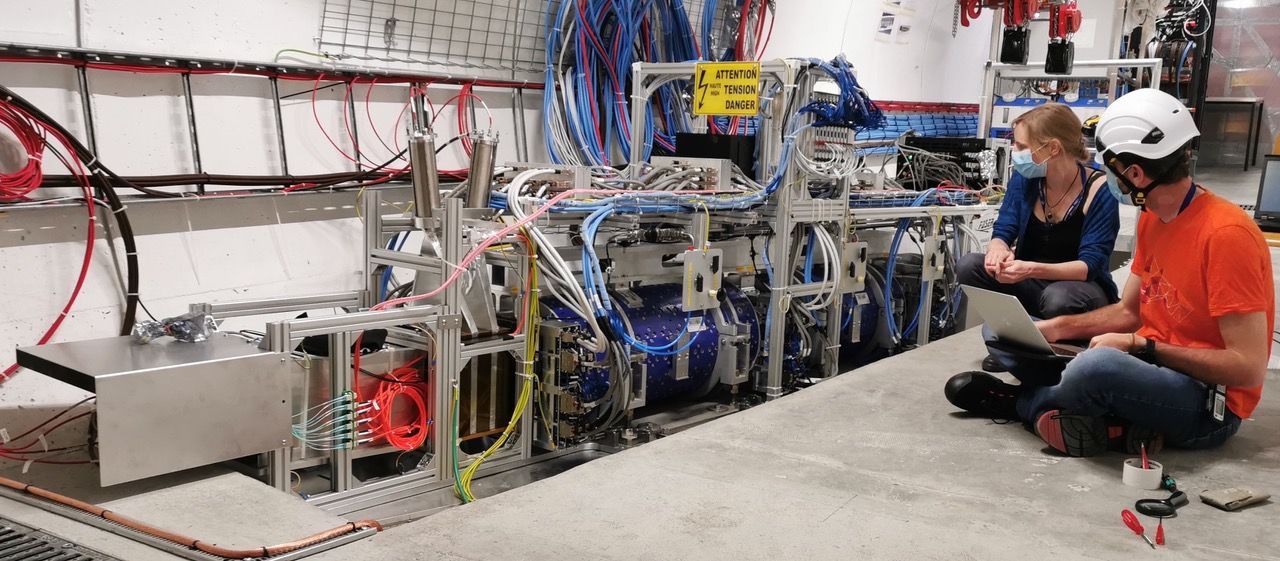
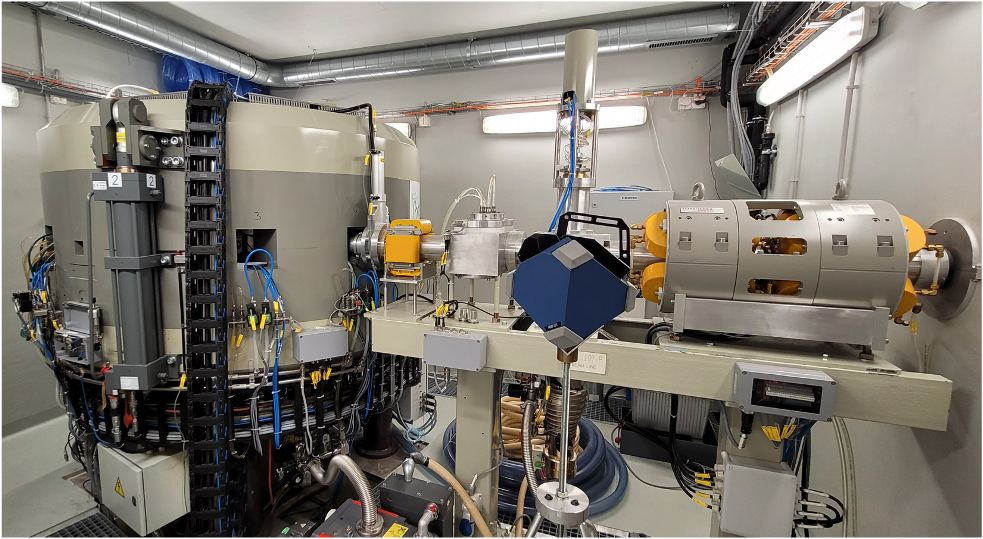



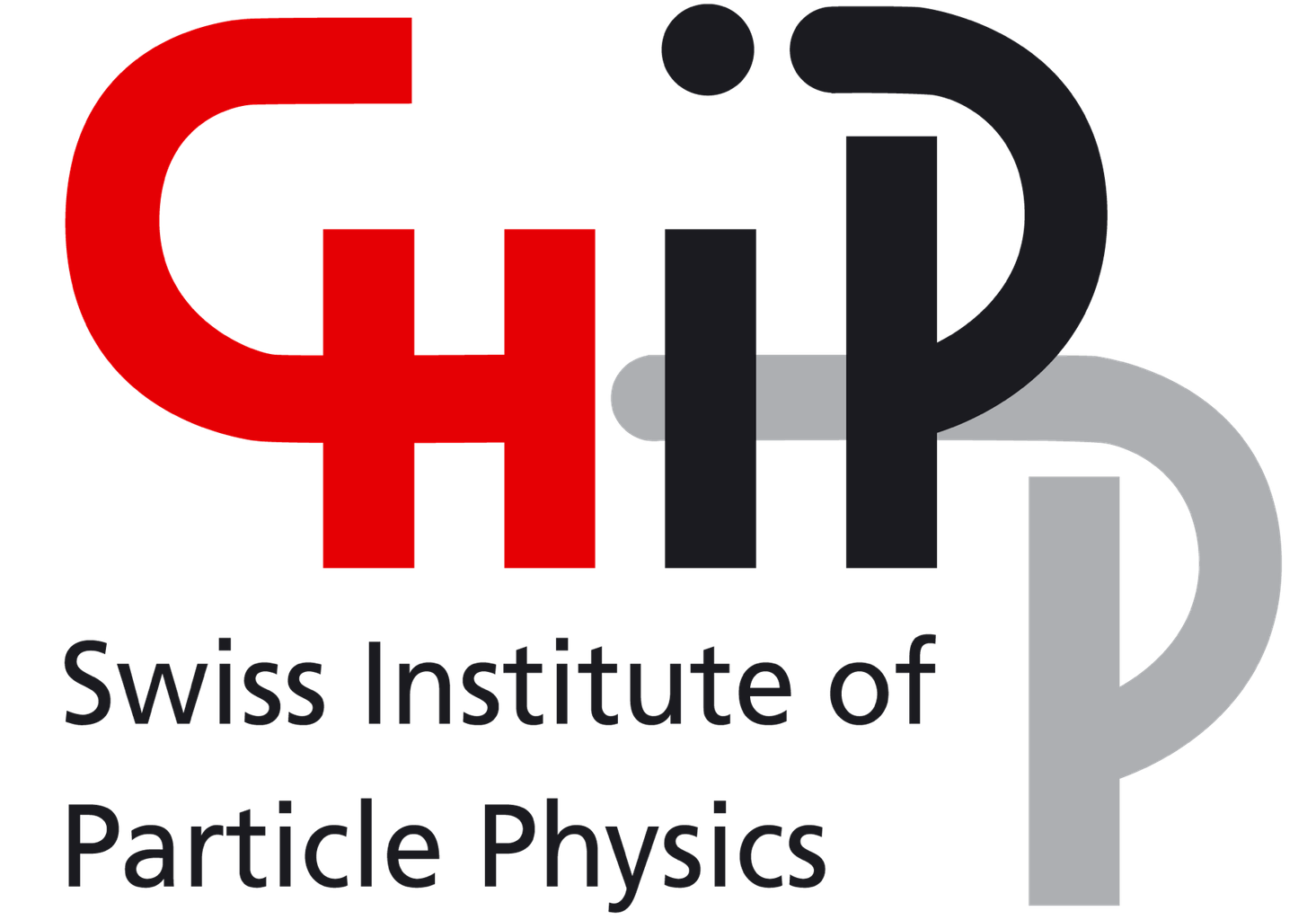


![Comparison between RK measurements. The measurements by the BaBar and Belle collaborations combine B+→K+ℓ+ℓ− and B0→KS0ℓ+ℓ− decays, where ℓ is a lepton. The previous LHCb measurements and the new result [4], which supersedes them, are also shown. Comparison between RK measurements. The measurements by the BaBar and Belle collaborations combine B+→K+ℓ+ℓ− and B0→KS0ℓ+ℓ− decays, where ℓ is a lepton. The previous LHCb measurements and the new result [4], which supersedes them, are also shown.](http://portal-cdn.scnat.ch/asset/40d25219-cf32-5d7f-a344-d4356ccc9252/Screenshot%202021-03-23%20at%2007.10.12.png?b=7f50075d-36d9-5913-bc44-fac8e7e34457&v=9bd7e834-a6a8-55b6-a09e-b7a43d64781f_100&s=ZXCr4RK3qEJY7uCaZs-9pRZZZ8OZ8EVj3Rtyhyf2-qP-evQun65d57tCLxGqXtaTEoil2Qpqb3qILXWzeagdRAk0VyPfdvD6i55sqpj1txNkByqDDgqtsu4QPc8YaVnoTVyp_QF8cXZ9TucqIpINFjwWWfLF-52KvErWu9a54Gs&t=2f78dd92-7a22-4f43-a0bf-8326ef689cea&sc=2)